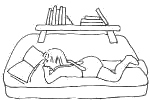von Hanna Vock
Entwertungen
Abwertungen und Entwertungen von Persönlichkeit sind immer schlimm. Erwachsene haben, wenn ihr Leben gut verlaufen ist, Strategien entwickelt, sich dagegen zu schützen und zu wehren, sofern sie über ein grundsätzlich positives Selbstbild verfügen. Wenn es aber so schlecht gelaufen ist, dass sie sich selbst nicht mehr wertschätzen können oder sich immer wütender wehren müssen gegen die Abwertung, die sie in der Gesellschaft, in ihrer Familie oder im Beruf erfahren (haben), ist es dramatisch schlimm.
Diese Prozesse der Wertschätzung oder Nicht-Wertschätzung beginnen schon in vor-sprachlichen Beziehungen. Aber uns sollen hier die hoch begabten Kinder im Kindergartenalter besonders interessieren.
Die Erzieherin Bianca Arens schrieb in einer ihrer Hausarbeiten für den IHVO-Zertifikatskurs:
„Hoch begabte Kinder spüren mit ihrer hohen Sensitivität, wenn ihre Bedürfnisse nicht beachtet werden und wenn ihre Persönlichkeit entwertet wird. … Entwertungen in der Familie können schon vorliegen, wenn die Eltern das Kind nicht das lernen lassen, was seinen Bedürfnissen entsprechen würde, sondern dies unterbinden, weil „es dafür noch zu klein“ ist. Oder wenn ein Kind von den Verwandten als ‚“altklug“ abgestempelt wird. … Die Kinder machen häufig die Erfahrung, dass im Ausdruck ihres Gegenübers etwas Befremdliches zu sehen ist als Antwort auf seine Äußerungen, sei es in den Gesichtern von Gleichaltrigen oder Erwachsenen.“
Was ist das Selbstkonzept eines Kindes?
(Diese Umschreibung des Begriffes gilt auch für Erwachsene; hier geht es aber wie im ganzen Handbuch um junge Kinder.)
Das Selbstkonzept des Kindes umfasst die Vorstellungen, die das Kind über sich selbst hat: über seine Eigenschaften, seinen Charakter, seine Fähigkeiten und seine Beziehungen zur sozialen Umwelt. Es ist ein komplexes System, das sich in der frühen Kindheit aufbaut, sich ausdifferenziert und auch korrigiert. Es erzeugt entsprechende Emotionen, also es wirkt sich beständig auf die Gefühlslagen des Kindes aus.
Das Baumaterial dieses Systems von Vorstellungen und Gefühlen, das sind zum einen die Rückmeldungen, die das Kind aus der sozialen Umwelt für sein Verhalten bekommt, zum anderen sind es die direkten Erfolge und Misserfolge des Kindes, die es bei seinem Handeln erfährt. Vermutlich spielen auch genetische, physiologische Anlagen eine Rolle.
Die Rückmeldungen aus der sozialen Umwelt können sprachlich sein:
„Wie siehst du denn wieder aus?“ „Dazu bist du noch zu klein.“ Oder aber: „Das schaffst du schon.“
Sie können körpersprachlich (insbesondere mimisch) sein, zum Beispiel (im Positiven) freudiges Strahlen der Mutter über die bestandene Schwimmprüfung oder (im Negativen) im Gesicht verziehen über das nach der Schwimmprüfung klitschnasse Handtuch.
Die Rückmeldungen können aus Taten bestehen, zum Beispiel wenn der Vater freudig mitspielt, nachdem ihn das Kind dazu aufgefordert hat, oder zum Beispiel wenn die Erzieherin dem Zweijährigen den Teller wegnimmt, sobald es den Kartoffelbrei mit den Fingern isst.
Es ist leicht vorstellbar, dass ein Kind, das über lange Zeit viele negative Reaktionen auf seine Verhaltensäußerungen erfährt, in Gefahr ist, ein negatives Selbstkonzept aufzubauen.
Und umgekehrt entwickelt ein Kind eher eine positive Sicht von sich selbst, wenn es viel Anerkennung erfährt.
Aber nicht nur die Reaktionen der sozialen Umwelt, auch eigene Erfolge und Misserfolge sind wesentlich für den Aufbau und Ausbau und Umbau des Selbstkonzepts.
Nicht nur die soziale Umwelt bewertet das Handeln des Kindes (über den Weg der Rückmeldung), auch das Kind selbst nimmt zu seinem Handeln und zu den Ergebnissen seines Handelns eine Bewertung vor. Diese kann durchaus auch schon beim kleinen Kind von der Bewertung durch die Umwelt abweichen. Dies umso mehr, je kritischer das Kind sich selbst und seine Umwelt bereits betrachten kann und je mehr eigene Gütekriterien es schon entwickelt hat.
Ein Kind kann einen Misserfolg sehen, wo die Umgebung Beifall klatscht, und es kann mit sich zufrieden sein, obwohl es die Unzufriedenheit (zum Beispiel der Eltern) spürt.
Beide Abweichungen sind für das Kind nicht leicht zu verarbeiten, aber für die Reifung des Selbstkonzepts sind solche abweichenden Bewertungen wesentlich.
Das Selbstkonzept hat zu jeder Zeit Auswirkungen auf die Gefühlslage und auf die Handlungsmotive des Kindes.
Und die hoch begabten Kinder?
Ein Merkmal hoch begabter Kinder ist, dass sie nicht nur früh und gründlich über die Dinge und Erscheinungen in ihrer Umwelt nachdenken, sondern auch über sich selbst. Sie entwickeln früher, als die Erzieher*in das von den anderen Kindern gewohnt ist, ein differenziertes Selbstbild. Ein menschliches Selbstkonzept hat viele Facetten, es enthält zum Beispiel auch die Frage: Werde ich gemocht, werde ich geliebt, bin ich selbst ein lieber Mensch? Es umfasst auch das Verhältnis zum eigenen Körper und die Art der Wahrnehmung der umgebenden Natur und vieles andere mehr. Hier in diesem Beitrag möchte ich denjenigen Bereich etwas beleuchten, bei dem es um kognitive Fähigkeiten und um Leistung geht, denn hier bestehen für hoch begabte Kinder besondere Möglichkeiten und besondere Probleme.
Siehe: Spezifische Probleme hoch begabter Kinder im Kindergarten.
Hoch begabte Kinder reflektieren und bewerten das, was sie getan haben, früher und oft auch gründlicher. Sie ziehen früher Rückschlüsse auf ihre eigenen Fähigkeiten, Leistungen und ihren Platz in der Gruppe. Sie entwickeln auf Grund ihrer intellektuellen Fähigkeiten früh ein komplexes Selbstkonzept. Dieses wird oft zunächst nicht deutlich nach außen sichtbar und wird deshalb auch von der sozialen Umgebung oft nicht genügend berücksichtigt.
Auf Grund ihrer geringen Lebenserfahrungen ist das Selbstkonzept der Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren noch nicht gefestigt, es ist im Aufbau, und deshalb kann jedes wesentliche Erlebnis des Kindes starke positive oder negative Auswirkungen auf sein Selbstkonzept haben. Die Auseinandersetzung mit den anderen Kindern im Kindergarten und den Erzieher*innen liefert dabei wichtige Bausteine für das Selbstkonzept des Kindes.
Schlichte-Hiersemenzel (2001b) schreibt: “Einflussnahme auf das Selbstkonzept des Kindes – gemeint ist ein nach innen und außen realitätsgerechtes Selbstkonzept mit Bewusstsein für eigene Stärken und Schwächen und selbstbejahender positiver Grundtönung – erfolgen über das emotionale Klima, Einstellungen und Haltungen der sozialen Umwelt, Mimik, Gestik und in nachhaltiger Weise auch über den Gebrauch der Sprache, die hoch begabte Kinder oft schon sehr früh in äußerst differenzierter Weise aufnehmen und auf die sie nicht nur kognitiv, sondern auch emotional reagieren.” (S. 66) Siehe: Literaturverzeichnis.
Auseinandersetzung mit Hochbegabung als Normalität
Die Kinder sollen die Möglichkeit erhalten, Isolationsgefühle zu überwinden, die sich im Kindergarten leicht einstellen, wenn die anderen Kinder ihre Interessen nicht teilen. Sie sollen in der Spielgruppe erfahren, dass ihre Interessen, ihr Wissensdurst usw. als normal angesehen werden.
Sie sollen die Möglichkeit haben, intellektuell an ihre Grenzen zu gehen und im Zusammensein mit anderen Kindern ihre Grenzen zu erkennen, was sie normalerweise in ihrer Kindergartengruppe auf intellektuellem Gebiet nicht erleben können. Das ist aus einem besonderen Grunde wichtig für sie: Hoch begabte Kinder sind im Alter von drei bis vier Jahren oft schon in einer Entwicklungsphase angekommen, wo der Vergleich und der Wettbewerb mit anderen eine bedeutsame Rolle spielt (was bei vielen anderen Kindern erst mit 6 bis 7 Jahren der Fall ist). Franz J. Mönks schreibt zum realistischen Selbstkonzept hoch begabter Kleinkinder:
„Im Alter von ungefähr 3 Jahren kennen sie schon die Stärken und Schwächen ihrer Leistungsfähigkeit. Sie setzen ihre eigenen Fähigkeiten in Beziehung zu anderen Kindern und erkennen die Unterschiede. Sie beschäftigen sich schon sehr früh mit ihrer eigenen Identität, setzen sich mit ihr auseinander (normalerweise eine zentrale Frage im Jugendalter).“ (in: Kleine Kinder – Große Begabung, S. 33)
Siehe: Literaturverzeichnis.
Deshalb ist es für die Kinder so wichtig, sich auch gerade in den Bereichen, in denen ihre Stärken liegen, betätigen und bestätigen zu können. Werden diese Stärken in dieser Entwicklungsphase nicht positiv beachtet und sozial verstärkt, können sich negative Folgen für das Selbstkonzept und insbesondere für das Selbstwertgefühl ergeben.
Durch das Spiel und die Konfrontation mit anderen hoch begabten Kindern kann das Kind aus seiner ständigen Außenseiterposition im Feld der intellektuellen Begabung herausfinden. Denn es kann ganz normale wechselnde Erfahrungen machen: Gewinnen ist genauso möglich wie Verlieren, Verstehen kann Anstrengung voraussetzen, andere wissen auch viel, und die Idee des anderen Kindes ist doch tatsächlich noch besser als meine eigene.
Gleichzeitig kann es sich als nötig erweisen, mit den Kindern ihre besonderen intellektuellen Begabungen ins Verhältnis zu setzen zu den Möglichkeiten und Bedürfnissen der anderen (nicht hoch begabten) Kinder.
Es ist für ihre soziale Entwicklung und ihre Einbindung in die Kindergartengruppe und später in die Schulklasse wichtig, dass die hoch begabten Kinder eine gute Balance finden zwischen Selbstbewusstsein und Freude an den eigenen Stärken einerseits und Achtung und Akzeptanz der Stärken der anderen Kinder andererseits. Die intellektuelle Isolation, die in der Spielgruppe stattfindet, soll nicht dazu führen, überhebliches Verhalten gegenüber den nicht hoch begabten Kindern zu begünstigen.
Hier sind in der Spielgruppe immer wieder die behutsame Intervention der Erzieher*innen und eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern notwendig.
Im einzelnen geht es für die hoch begabten Kinder darum zu tolerieren,
„dass andere Kinder manchmal etwas länger brauchen, bis sie zum Beispiel bestimmte Spielregeln verstanden haben;
dass andere Kinder nicht so gut sprechen können und Begriffe nicht so exakt definieren;
dass andere Kinder sich prügeln und raufen, obwohl das hochbegabten Kindern häufig unlogisch erscheint und zuwider ist.“ (Michael Hollenbach, S. 35f.)
Siehe: Literaturverzeichnis.
Andererseits ist es für das Selbstbewusstsein der hoch begabten Kinder wichtig zu erkennen, dass sie von den anderen Kindern auch etwas erwarten dürfen: nämlich dass diese tolerieren,
„dass hochbegabte Kinder keine Lust haben, bestimmte Spiele zum x-ten Mal zu wiederholen;
dass Kinder auch dann liebenswerte und gleichberechtigte Spielkameraden sind, wenn sie Angst vorm Klettern oder Rutschen haben und sich aus Streitereien heraushalten;
dass es ganz „normal“ sein kann, wenn man sich öfter mal ausklinkt, um seine eigenen Interessen wie Lesen oder Zeichnen zu verfolgen.“ (ebenda)
Die Wichtigkeit von Erklärungsmustern
Ein Beispiel aus meiner Beratungspraxis:
Arne (3;11) konnte schon viel und scharf denken, verfügte aber trotzdem erst über die Lebenserfahrungen eines Dreijährigen.
Die frühe Neigung, logische Schlussfolgerungen zu ziehen, über Erlebtes nachzudenken, sich mit anderen zu vergleichen, Situationen komplex wahrzunehmen und zu beurteilen, kam in Konflikt mit dieser geringen Lebenserfahrung.
Dies kann leicht zu falschen Schlussfolgerungen und zu heftigen Schwankungen des Selbstkonzepts führen, wie am folgenden Beispiel zu sehen ist.
Die Episode passierte, als Arne 3;11 Jahre alt und neu im Kindergarten war. Er hatte zu Hause bereits Schach spielen gelernt und wollte jeden Abend mit seinem Vater spielen.
In den ersten Tagen seiner Kindergartenzeit sah er, wie die großen (die sechsjährigen) Kinder aus einer Spielesammlung ein Schachspiel auspackten, die Figuren auf das Brett stellten und “Schach spielten”. Keines der Kinder kannte die Schach-Regeln, aber sie spielten ausgiebig und völlig altersgemäß “so als ob”.
Arne beobachtete das Spiel der Kinder, wie die Erzieherin später erzählte, ausdauernd und still.
Nach einiger Zeit begann sich der Vater zu wundern, weil Arne unfreundlich zu ihm war und auch nicht mehr mit dem Schachspiel ankam, um ihn zum Spielen aufzufordern. Er fragte seinen Sohn nach dem Grund. Der antwortete schließlich, er könne ja gar nicht Schach spielen und ließ sich auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Es zeigte sich, dass Arne seinem Vater böse war, weil er glaubte, dass ihm der Vater “Babyschach beigebracht” hatte.
Die Mutter fand schließlich heraus, dass ihr Sohn im Kindergarten versucht hatte, die Regeln zu verstehen, nach denen die Kinder spielten, was ihm natürlich nicht gelingen konnte, da die Kinder völlig regellos spielten. Die Eltern fanden heraus, dass Arne jetzt glaubte, dass er zu dumm oder noch zu klein sei, um die “richtigen” Regeln der Großen zu verstehen.
Die Vermutung liegt nahe, dass der dreijährige Junge sich nicht vorstellen konnte, dass die sechsjährigen Kinder, die er als viel größer, viel älter, in vielem selbstständiger und erfahrener erlebte, etwas nicht konnten, das er selbst beherrschte und das ihm leicht fiel.
Auf Grund seiner falschen Schlussfolgerung produzierte er negative Gefühle: Enttäuschung und vielleicht auch Scham darüber, dass er noch gar nicht Schach spielen könnte und dass er klein und dumm sei; Wut auf den Vater, weil der ihn vermeintlich getäuscht hatte; Unlust gegenüber dem Schachspiel.
Arne brauchte in dieser Situation dringend ein Erklärungsmuster für sein Erlebnis im Kindergarten, das die Wirklichkeit besser abbildete als sein eigener Versuch und das sein Selbstkonzept (und seine Motivation zum Schachspiel) stützte.
Darf man einem kleinen Kind sagen, dass es hoch begabt ist?
Aber darf man das? Darf man einem Kind sagen, dass es weiter oder klüger ist als die anderen Kinder? Erzieher*innen wie auch Eltern berichten von Hemmungen, dies zu tun. Zwei Befürchtungen hindern sie, dem Kind in einer solchen Situation die Wahrheit zu sagen:
- erstens die Sorge, das Kind könnte überheblich und arrogant werden;
- zweitens die Sorge, das Kind könnte mit anderen Kindern oder Erwachsenen unbefangen darüber sprechen und sich (und seine Eltern) damit unbeliebt machen.
Die erste Sorge halte ich für genau so unbegründet wie die mögliche Sorge, ein Kind könnte nur deshalb arrogant werden, weil es schneller laufen, früher schwimmen, schöner malen oder besser singen kann als gleichaltrige Kinder.
Mähler und Hofmann (2002) sehen dies ähnlich: “Ob Ihr Kind drei oder zehn Jahre alt ist: Wenn Sie ihm vermitteln, dass Hochbegabtsein kein Grund für Arroganz ist, so wird Ihr Kind diese Haltung übernehmen.” (S. 45) Siehe: Literaturverzeichnis.
Die zweite Sorge wiegt schwerer. In vielen Beratungsgesprächen berichteten mir Eltern, dass sich das Verhalten von Nachbarn und Bekannten (zum Beispiel auch anderer Kindergarteneltern) merklich veränderte, nachdem die Hochbegabung oder auch nur die vermutete Hochbegabung ihres Kindes bekannt geworden war.
Diese Verhaltensänderungen wurden meistens als negativ empfunden. Es wurde von all den Verhaltensweisen berichtet, die Menschen in Außenseiterpositionen entgegengebracht werden. Eltern berichteten: von skeptischen Rückfragen; von seltsam motivierten Annäherungsversuchen (Annika und Carina könnten sich doch mal anfreunden und öfter miteinander spielen – im Schulalter: Hausaufgaben zusammen machen); von Neidbekundungen oder unterschwelligem Neid; von Berührungsängsten bis zum völligen Abbruch des Kontakts und dem Verbot, mit dem hoch begabten Kind zu spielen.
Eltern, die mit der Hochbegabung der eigenen Kinder im Bekanntenkreis und in der Öffentlichkeit offen umgehen, begeben sich in Deutschland heute noch geradewegs in eine Außenseiterposition. Nicht alle Eltern wollen das sich und ihren Kindern zumuten. Deshalb muss die Erzieherin diese Sorge ernst nehmen, sich über die Einstellung der Eltern vergewissern und entsprechend taktvoll mit dem Begriff Hochbegabung umgehen.
Siehe: Den Begriff Hochbegabung vorsichtig verwenden
Dass ein solcher taktvoller Umgang nicht selbstverständlich ist, zeigt das Beispiel einer Grundschulrektorin, die nach einem vertrauensvollen Aufnahmegespräch mit Eltern eines hoch begabten Kindes am nächsten Tag ohne Rücksprache mit den Eltern die Presse davon benachrichtigte, dass sie nun ein hoch begabtes Kind an ihrer Schule habe, und die Reporterin mit dem hoch begabten Kind zusammen brachte. Das ist sicher ein sehr krasser Fall, aber er sollte zu denken geben.
Wenn also von Seiten der Erzieherin Zurückhaltung angebracht ist und hoch begabte Kinder und ihre Eltern nicht zwangsweise “geoutet” werden dürfen – wie kann es dann gelingen, dem Kind die nötigen Erklärungsmuster für sein Anderssein zu geben?
Schlichte-Hiersemenzel (2001a) schreibt dazu: “Zugewandtes, einfaches Benennen von Fähigkeiten und Verhaltensweisen, in denen ihre ungewöhnliche Begabung zum Ausdruck kommt, kann eine unmittelbar entlastende Wirkung auf die hoch begabten Kinder und Jugendlichen haben.” (S.41) Siehe: Literaturverzeichnis.
Vieles ist Kunst
Als ich in meiner Zeit als Erzieherin im Kindergarten in der Auseinandersetzung mit der Begabtenförderung an diesem Punkt angekommen war, führte ich in der Kindergartengruppe den Begriff “Kunst” ein. Mit “Kunst” bezeichnete ich von nun an in der Gruppe alle besonderen Fähigkeiten von Kindern. Der Begriff wurde von den Kindern schnell übernommen. So zeigte ein Kind besondere Schleifen-Binde-Künste, ein anderes beherrschte besonders gut die Tisch-Abwisch-Kunst, die Ball-Fang-Kunst oder die Tröste-Kunst. Bei wieder anderen wurde eine besondere Wasser-Schlepp-Kunst entdeckt (wenn im Sommer viele, viele Gießkannen voll Wasser zum Spielen gebraucht wurden).
Es erschien den Kindern ganz natürlich – was es ja auch ist – dass es auch Rechen-Kunst, Schreib-Kunst, Lese-Kunst, Puzzle-Kunst oder Denk-Kunst gab. Auch diese kognitiven Fähigkeiten wurden genauso selbstverständlich gewürdigt wie alle anderen.
Dadurch dass ein griffiger, kindgerechter Begriff eingeführt wurde, um besondere Fähigkeiten zu benennen, konnten auch die Kinder untereinander darüber sprechen. Für den Umgang mit dem Begriff ist die Erzieherin Vorbild:
Wichtig ist, dass von der Erzieherin die besonderen Fähigkeiten (Künste) aller Kinder erkannt und benannt werden, was einer Erzieherin, die ihre Kinder gut kennt, gelingen wird.
(Eine IHVO-Kurs-Teilnehmerin setzte diese pädagogische Anregung so um:
Professoren, zeigt euch!)
Fähigkeiten, die gerade gezeigt wurden, und Leistungen, die vor kurzem vollbracht wurden, können konkret und auf die Situation bezogen als “Kunst” (oder mit ähnlichen Begriffen, die Erzieher*innen dafür erfinden) betitelt werden.
Manchmal kamen die Kinder auch mit Ideen, die diskutiert werden mussten: Ist es Kunst, wenn ein Kind andere besonders gut ärgern kann? Da diese Tätigkeit eindeutig gegen unsere Kindergartenregeln verstieß, war es nicht schwierig zu dem Schluss zu kommen, dass das keine Kunst ist, “sondern Mist” (Originalton hoch begabtes Kind). Auch die Begriffsfindung “Mist” wurde als gute Idee gewürdigt; “Mist” wurde von den Kindern in das Grundvokabular der Gruppe übernommen, als Oberbegriff für destruktive Fähigkeiten und Handlungen.
Hierbei muss die Erzieherin selbst Farbe bekennen und ihren Erziehungsauftrag ernst nehmen: Sie muss in dem Mikrokosmos Kindergartengruppe vertreten können, dass manche Ideen besser sind als andere, dass vieles “Kunst”, manches aber auch “Mist” ist.
Hoher Anspruch an das eigene Können
Albert Einstein hatte in seinen frühen Kinderjahren eine Eigenheit:
„Er formt in Gedanken zunächst vollständige Sätze, probt sie dann mit verhaltener Stimme, bewegt dabei die Lippen, und erst wenn alles gut zusammenpasst, spricht er sie mit seiner Kinderstimme laut aus. Bis in die ersten Schuljahre hinein begleitet ihn sein sonderbares Verhalten.“
(Quelle: Jürgen Neffe, Einstein. Eine Biografie, S. 27)
Häufig wird in der Literatur als problematisches Merkmal hoch begabter Kinder „Perfektionismus“ angeführt. Damit ist gemeint, dass das Kind mit seinem Spiel- oder Arbeitsergebnis oft oder meistens nicht zufrieden ist und sich damit quält, dass es die Sache nicht besser hinkriegt. Pädagogen und Psychologen versuchen, den Kindern „den Druck, den sie sich selber machen“, zu nehmen. Es wird versucht, sie vom Perfektionismus zu befreien.
Äußerungen von Erzieherinnen in IHVO-Fortbildungsveranstaltungen:
– „Ich wünsche mir, dass er seinen Perfektionismus noch überwindet, damit er dann in der Schule besser zurecht kommt.“
– „Mit ihrem Perfektionismus steht sie sich oft selbst im Wege.“
Es werden vor allem negative Dinge wahrgenommen:
– der Angstanteil (meine Leistung ist nicht gut genug / ich bin nicht gut genug);
– der Leistungsverhinderungsanteil (das Kind braucht zu viel Zeit und ist durch Unzufriedenheit blockiert);
Können wir den beobachteten Perfektionismus hoch begabter Kinder auch positiv als einen grundsätzlich höheren Anspruch an das angestrebte Ergebnis sehen? Ich möchte hiermit auch dafür plädieren, das Wort „Perfektionismus“ aus dem pädagogischen Vokabular zu streichen und durch „hoher Anspruch an die eigene Leistung“ zu ersetzen.
Zunächst ist zu prüfen, ob der Anspruch wirklich absurd hoch ist und man dem Kind helfen kann, realistischer zu werden und dadurch mit seinen Ergebnissen zufriedener zu sein
oder ob es gelingen kann, ihm Hilfe, Anleitung und Unterstützung zu geben, damit es seine Ziele erreichen kann.
Hierzu ein Beispiel aus meiner eigenen Kindergartenpraxis, das ich schon im Handbuch-Beitrag: Spielgefährten und Freunde hoch begabter Kinder berichtet habe. Ich füge es hier noch einmal ein und betrachte es aus einem anderen Blickwinkel.
Marja war fünf Jahre alt, als sie in unseren Kindergarten wechselte. Da hatte ich wieder so ein Kind, das mit Gleichaltrigen nicht viel anfangen konnte. Spielangebote der anderen Kinder lehnte sie oft ab. Sie war still, beobachtete viel, aber ließ sich selten auf gemeinsames Spiel ein. Marja sprach aber sehr gut, konnte sich sehr differenziert und genau ausdrücken und liebte schwierige Geschichten. Ich suchte nach einer Erklärung, warum Marja so wenig Lust auf Zusammenspiel hatte. Kasper und Krokodil kamen mir zu Hilfe:
Unser Kindergarten hatte neue Kasperpuppen gekauft, nach einer längeren Zeit ohne Puppentheater. Mit Kasper und Krokodil spielte ich eine Geschichte, in der die Beiden sich zunächst friedlich unterhielten, aber dann in Streit gerieten. Am Ende versuchte das Krokodil den Kasper zu beißen. Kasper ließ sich das nicht gefallen, er verjagte das Krokodil. Ein großer Teil der Kindergartengruppe sah zu.
Jetzt übernahmen die Kinder die Puppen. Jeweils ein Kind spielte den Kasper, das andere das Krokodil. Dann wurden die Puppen an andere Kinder weiter gegeben. Marja stand still neben mir, beobachtete, aber machte keinen Versuch, an die Reihe zu kommen. Die Geschichte, die die Kinder spielten, enthielt kaum Worte, keinen verbalen Streit, aber immer eine kräftige Prügelei und viel Geschrei und Dramatik: Kasper ruft Krokodil – Krokodil taucht auf und beißt den Kasper – Kasper schlägt heftig auf das Krokodil ein – Krokodil flieht – Gelächter – Beifall – aus. Eine altersgemäße Adaption des Stoffes, an der wir in der Folge mit den Kindern arbeiten konnten im Sinne von Ausbau und Differenzierung. Den Kindern, Spielern wie Zuschauern, war ein großes Vergnügen anzusehen.
Nur nicht Marja. Auf meine Frage, ob sie auch spielen wolle, antwortete sie zunächst entschieden mit Nein. Bei meiner Nachfrage einige Minuten später flüsterte sie: „Ja, aber mit dir.“ Also wieder ein Kind, das sich „an die Erzieherin hängte“ anstatt sich auf die anderen Kinder einzulassen? Welchen Grund hatte sie dafür?
Der Grund wurde deutlich, als ich mit ihr spielte. Es zeigte sich, dass sie nicht nur meine recht komplizierte Geschichte gespeichert hatte und nachspielen wollte, sondern dass sie eine eigene Idee einfügte. Als das Krokodil (ich) anfing, nach dem Kasper zu schnappen, wich sie aus und rief: „Wenn du mich heute beißt, kriegst du morgen einen Maulkorb – für alle Zeiten, dass du das weißt!“ Die Geschichte nahm dann spontan eine verträgliche Wendung, wobei Marja geschickt improvisierte.
Fazit:
Marja hatte einen hohen Anspruch an das Ergebnis der Tätigkeit. Sie wollte „eine richtige Geschichte“ spielen und sie analysierte die Situation treffsicher. Sie beobachtete das Geschehen und zog die Schlussfolgerung, dass sie ihre Vorstellung von einer richtigen Geschichte mit den anwesenden Kindern nicht verwirklichen konnte. So kam ihr traurig-frustrierter Gesichtsausdruck zustande und ihr geflüsterter Wunsch an die Erzieherin – geflüstert, weil sie aus ihrem alten Kindergarten wusste, dass sie sich damit neben die Gruppe stellte und eine „Extrawurst“ haben wollte. Marjas anfängliche Weigerung mitzuspielen war also nicht Ausdruck eines unterentwickelten Sozialverhaltens, wie man zunächst hätte denken können, sondern Ausdruck ihrer fortgeschrittenen geistigen Entwicklung.
Marja konnte einen (stärkenden) Erfolg erleben und sah sehr zufrieden aus.
Auch beim Malen und Zeichnen konnte ich des Öfteren erleben, dass hoch begabte Kinder unzufrieden mit ihrem Ergebnis waren, auch wenn die Kollegin sagte: „O das ist aber ein schönes Bild!“ Der eigene Maßstab des Kindes war ein anderer, zum Beispiel sollte der gezeichnete Gegenstand klar erkennbar sein. Mit einem Mädchen, das diesen Anspruch hatte, veranstaltete ich mit wenig Aufwand, quasi nebenbei, einen Zeichenkurs, ähnlich dem, den Silvia Hempler beschreibt: Zeichenkurs mit Linda.
Beachten Sie dazu auch den Beitrag: Zeichnen üben mit 4.
Dieser Weg hilft dem Kind, seinen hohen inneren Anspruch zu klären, im Prinzip beizubehalten und besser zu erfüllen, also rasant und mit guter Unterstützung zu lernen.
Auch aus Fehlern, aber vor allem aus Erfolgen lernen wir.
Der Mensch lernt aus seinen Fehlern. Heißt es. Ein Wissenschaftler am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge, USA widerspricht dieser Auffassung. Im Anschluss an eine Studie behauptet Earl Miller: „Unser Gehirn lernt aus Erfolgen – und zwar effizient und schnell.“
Die Autorin Anne Gielas berichtet und zitiert in der Zeitschrift „Psychologie heute“ weiter aus dem Forschungsbericht:
„Mit seiner Forschung untersucht der Neuropsychologe, wie die Rückmeldungen unseres Umfelds das Lernen beeinflussen. Miller ist es erstmalig gelungen, diesen Lernprozess anhand der Reaktion einzelner Gehirnzellen nachzuvollziehen. Hierfür hat der Wissenschaftler gemeinsam mit Kollegen in hirnphysiologischen Studien die neuronalen Abläufe bei Affen erforscht. Die Tiere bekamen zwei Bilder gleichzeitig gezeigt, wobei sie bei bestimmten Motiven nach links, bei anderen wiederum nach rechts schauen sollten. Auf ihre Reaktionen folgte das Feedback der Forscher, die sie für die richtigen Reaktionen lobten, auf Fehler wiederum aufmerksam machten. …
„Befolgten sie (die Affen) die Aufgabe richtig und ernteten positive Rückmeldungen, zeigten ihre Neuronen anschließend eine verbesserte Leistung“, erklärt Miller.
Nach fehlerhaften Reaktionen stellte das Wissenschaftlerteam jedoch keine oder nur geringe Unterschiede in der Leistung fest. Daraus schlussfolgert Miller, dass Erfolge und positives Feedback ausschlaggebend für das Lernen seien. Aber wieso lernen wir mehr aus erfreulichen Rückmeldungen als aus Kritik? „Das Gehirn neigt wahrscheinlich deshalb zur verstärkten Verarbeitung positiver Rückmeldungen, weil diese generell mehr Informationen liefern“, lautet Millers Vermutung.
Nach: Earl Miller u. a.: Learning substrates in the primate prefrontal cortex and striatum: Sustained activity related to successful actions. Neuron, 63, 2/2009, 244-253
Zitiert nach: Psychologie heute, August 2010, S. 15.
Beobachtungen aus meiner Zeit als Kita-Erzieherin:
Annie
Die gerade dreijährige Annie versucht, eine Mauer aus rechteckigen Holzbausteinen zu bauen. Zunächst setzt sie die Klötze nicht akkurat aufeinander, die Mauer gerät immer mehr in Schieflage und stürzt schließlich um.
Lerneffekt: Hat nicht geklappt, keine Ahnung warum. Kein Erfolgserlebnis.
Sie wiederholt den Versuch, setzt aber als Basis drei vergleichsweise kleine Klötze ein und stapelt größere darüber. Ein anderes Kind mischt sich ein: „Du musst unten große Steine nehmen.“ Annie stutzt kurz, baut aber weiter, bis die Mauer sehr schnell wieder einstürzt.
Lerneffekt: Je nachdem:
– Annie bezog Misserfolge schon vornehmlich auf sich selbst (es liegt an mir). Ihre Reaktion: Ich kann das nicht. Folge: Ich lasse das. Kein Lerneffekt, sondern die Bestätigung einer negativen Zuschreibung.
Um zu erreichen, dass diese (für weiteres Lernen) verhängnisvolle Selbsteinschätzung sich erst gar nicht weiter verfestigt, brauchte Annie zweierlei: Zum Ersten im Kindergarten eine gezielte Hinführung zu möglichst vielen Erfolgserlebnissen, die ihr auch durch ausgesprochene Bestätigung bewusst gemacht wurden. Und zum Zweiten ein Elterngespräch, das die Lage für die Eltern transparent macht und ihnen Wege aufzeigt, ihrer Tochter viel zuzutrauen und sie gegebenenfalls bei der Erreichung ihrer Ziele praktisch zu unterstützen – nicht indem etwas für sie gemacht wird, sondern indem gute Hinweise gegeben werden.
Katja
In einer ganz ähnlichen Situation war die gleichaltrige Katja. Sie verfügte jedoch schon über ein stabileres Selbstwertgefühl als Annie; Katja war zum Beispiel bewusst, dass sie schon vieles geschafft hat, was zuerst nicht gehen wollte.
Anscheinend dachte sie nun: So geht es nicht.
Diese Schlussfolgerung kratzt mitnichten an ihrem Selbstwertgefühl. Deshalb ist die Chance ungleich größer, dass sie nicht so schnell aufgeben wird. Sie wird wahrscheinlich herausfinden wollen, wie es denn gehen könnte. Sie erlebt den momentanen Misserfolg nicht als Scheitern, sondern eher als interessante Herausforderung.
Diese Haltung bewirkt, dass Katja nicht nur für weiteres Probieren, sondern auch offen ist für gute Ratschläge und weiteres Lernen.
Annie
Im dritten Anlauf beherzigt Annie den Rat des anderen Kindes, setzt aber die Steine immer noch genauso ungenau aufeinander. Die Mauer stürzt, wieder kein Erfolgserlebnis.
Lerneffekt: Hat wieder nicht geklappt. Etwas mache ich falsch (denn andere können es doch auch)! Was muss ich anders machen? Bei einem guten Vertrauensverhältnis zur Erzieherin oder älteren Kindern kann es um Hilfe fragen und wird vermutlich den Hinweis erhalten, dass es die Bauklötze ganz genau aufeinander setzen muss.
Nun versucht sie, auf einer ordentlichen Basis die Steine sorgfältiger auszurichten.
Und siehe da, es klappt! Annie geht gestärkt aus ihren Versuchen heraus.
Es wäre aber negativ für sie ausgegangen, wenn weder das andere Kind noch die Erzieher*in Annie beobachtet und ihr geholfen hätten. Hier kann die Erzieher*in noch mal verstärken: „Du kannst mich um Rat oder Hilfe fragen, wenn wieder mal was nicht klappen will.“
Selbstkonzept und Selbstwertgefühl
setzen sich aus vielen Erfolgs-/ Misserfolgserlebnissen und deren Verarbeitung zusammen – und das beginnt bei hoch begabten Kindern schon sehr früh im Kindergartenalter.
Datum der Veröffentlichung: Dezember 2021
Copyright © Hanna Vock siehe Impressum.